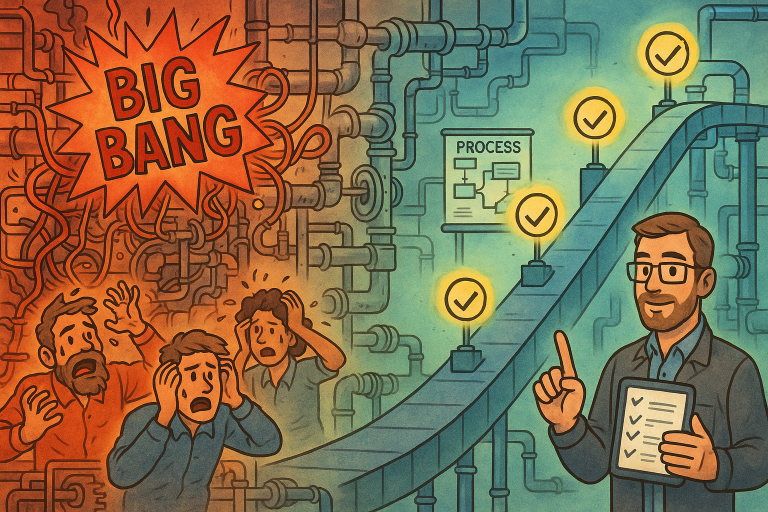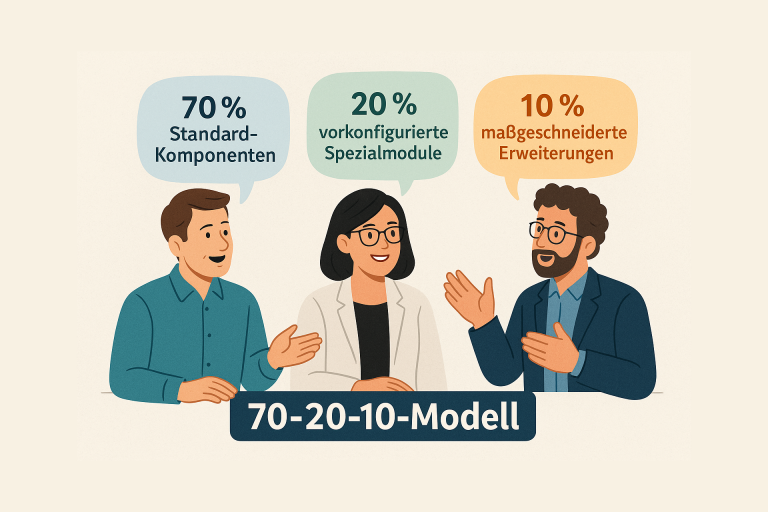Low-Code ist kein Allheilmittel – aber dort, wo Abläufe klar beschrieben sind, entfaltet es enorme Wirkung.
Dieser Artikel zeigt: wo Low-Code sinnvoll ist, wo seine Grenzen liegen und wie Unternehmen ohne Risiko starten können.
ERP-Systeme im Mittelstand sind oft wie Beton: stabil, aber schwer formbar.
Low-Code verspricht Tempo, weniger Abhängigkeiten und mehr Kontrolle –
wenn Prozesse, Datenstrukturen und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind.
In diesem Artikel erfahren Sie, wo Low-Code wirklich wirkt, wo es an seine Grenzen stößt und wie Sie mit einem strukturierten Pilotprojekt messbare Ergebnisse erzielen.
Was Sie in diesem Artikel bekommen
✅ Eignungsfälle und Grenzen mit Entscheidungsmatrix
✅ Richtlinienrahmen und Betriebsmodell für sicheres Arbeiten
✅ Praxisbeispiel mit echten Kennzahlen
✅ Checkliste und risikoarmer Startpfad
❌ Kein Hype, kein Heilsversprechen
Wo Low-Code wirkt – und wo nicht
Low-Code entfaltet seine Stärke dort,
wo Abläufe regelbasiert, nachvollziehbar und wiederkehrend sind.
Nicht dort, wo Hochleistungsberechnungen oder Speziallogiken dominieren.
Entscheidungsmatrix: Wann Low-Code geeignet ist
| Prozessbereich | Geeignet für Low-Code | Grund / Nutzen |
|---|---|---|
| Angebotswesen, Freigaben, Formularlogik | ✅ Ja | Standardisierbar, schnell anpassbar, nachvollziehbar |
| Stammdatenpflege, Aufgabenrouting | ✅ Ja | Klare Regeln, feste Abläufe |
| Prüf- und Nachweisschritte (z. B. ISO, Qualitätssicherung) | ✅ Ja | Dokumentierbar, auditierbar |
| Physikalische Berechnungen, CNC-Steuerung | ❌ Nein | Speziallogik, hohe Rechenanforderung |
| Echtzeitplanung oder Simulation | ❌ Nein | Zu komplex, Spezialsoftware wirtschaftlicher |
Daumenregel:
Enthält ein Prozess mehr als 30 % Speziallogik oder Echtzeitanteile,
ist klassische Programmierung meist effizienter.
Die häufigsten Missverständnisse
„Low-Code ersetzt die IT“ – nein, sie bleibt der Dirigent
Low-Code entlastet die IT, aber macht sie nicht überflüssig.
Die IT legt die Spielregeln fest – Datenstrukturen, Sicherheit, Freigaben –
und sorgt dafür, dass alles technisch sauber zusammenpasst.
Die Fachabteilungen gestalten ihre Abläufe selbst,
aber innerhalb dieser Leitplanken.
So bleibt die IT der Dirigent,
und die Fachbereiche spielen endlich mit – statt nur Tickets zu schreiben.
„Low-Code kann alles“ – das führt zu falschen Erwartungen
Low-Code ist kein Werkzeug für Spezialfälle, Simulationen oder physikalische Modelle.
Seine Stärke liegt in klaren Prozessen, nicht in Hochleistungsberechnungen.
Wenn Sie Genehmigungen, Formularlogik oder Freigaben automatisieren wollen,
ist Low-Code ideal – schnell, verständlich und flexibel.
„Low-Code ist Selbstbedienung ohne Regeln“ – nur mit Leitplanken sicher
Ohne klare Regeln wird Low-Code schnell zur Schatten-IT.
Damit Flexibilität nicht in Chaos endet, braucht es klare Vorgaben:
Daten müssen zentral bleiben, Änderungen dokumentiert, Tests verbindlich.
Nur dann funktioniert Eigenständigkeit mit System.
So bleibt Low-Code sauber – Richtlinienrahmen und Betriebsmodell
Richtlinienrahmen
Zentrales Datenmodell:
Alle Anwendungen greifen auf dieselbe geprüfte Datenbasis zu.
Einheitliche Namensregeln:
Felder, Module und Abläufe folgen festen Bezeichnungen.
Getrennte Umgebungen:
Entwicklung, Test und Nutzung sind klar voneinander getrennt.
Wöchentliche Anwendungsprüfung:
Neue oder geänderte Anwendungen werden regelmäßig gemeinsam geprüft.
Geplante Freigaben:
Neue Versionen werden gebündelt zweimal pro Monat veröffentlicht.
Schnellkorrekturen mit Rücksetzung:
Notfalländerungen dürfen nur erfolgen, wenn sie innerhalb von fünf Minuten sicher zurückgesetzt werden können.
Verpflichtende Tests:
Mindestens ein Standardablauf und zwei Grenzfälle müssen erfolgreich geprüft sein.
Klare Verantwortlichkeiten:
Für jede Anwendung sind ein Prozessverantwortlicher und eine Prüferin benannt.
Betriebsmodell
Pflegeanteil:
80 % der Anpassungen erfolgen durch die Fachbereiche, 20 % durch die IT.
Schulung:
Jede beteiligte Person erhält eine zweistündige Einführung in Aufbau, Logik und Prüfregeln.
Vorlagenbibliothek:
Häufige Prozessmuster (z. B. Freigaben, Prüfabläufe, Formulare) stehen als Vorlagen bereit.
Qualitätssicherung:
Jede Änderung wird dokumentiert, getestet und nach festgelegtem Verfahren freigegeben.
Rollout-Rhythmus:
Neue Funktionen werden quartalsweise eingeführt, ohne Ausfallzeiten im laufenden Betrieb.
Überwachung:
Laufende Anwendungen werden über Kennzahlen zu Stabilität, Nutzung und Fehlerquote überwacht.
Zusammenarbeit:
Fachbereiche und IT arbeiten partnerschaftlich – Fachlogik und Technik greifen ineinander.
Risiken und Gegenmaßnahmen
| Risiko | Gegenmaßnahme |
|---|---|
| Schatten-IT | Zentrales Datenmodell, gemeinsame Anwendungsübersicht, klarer Freigabeprozess |
| Inkonsistente Daten | Einheitliche Namensregeln, definierte Datenquellen, Feldpflege durch Fachbereich |
| Leistungsprobleme | Lasttests vor Freigabe, definierte Nutzungsgrenzen pro Anwendung |
| Abhängigkeiten zwischen Modulen | Fester Freigaberhythmus, Versionsplanung, Abstimmung zwischen Teams |
| Fehlende Qualitätssicherung | Regelmäßige Prüfungen, dokumentierte Testszenarien und Rücksetzplan |
| Wissensverlust bei Personalwechsel | Prozessverantwortliche benannt, Schulungsunterlagen zentral dokumentiert |

Praxisbeispiel: Vom Engpass zur Eigenständigkeit
Ein Maschinenbauer wollte seinen Angebotsprozess beschleunigen.
Vorher: fünf Abteilungen, 120 Angebote pro Monat, drei Tage Bearbeitungszeit, manuelle Excel-Kalkulation.
Nachher:
- Durchlaufzeit: 3 Tage → 6 Stunden
- Änderungsaufwand je Regel: – 55 %
- Nachbearbeitungsfehler: – 32 %
- IT-Tickets: – 40 %
Rahmenbedingungen:
Eigenes Rechenzentrum, Private-Cloud-Umgebung, keine Downtime, Schulung: 2 Stunden pro Team.
Der Geschäftsführer brachte es auf den Punkt:
„Zum ersten Mal arbeitet unser ERP so, wie wir denken – nicht umgekehrt.“
Sicherheit und Datenschutz
- Zugriffe sind rollenbasiert und auf das Notwendige beschränkt.
- Änderungen werden automatisch versioniert und dokumentiert.
- Alle Anwendungen nutzen zentrale Datenquellen.
- Datenschutz und Nachvollziehbarkeit sind jederzeit gewährleistet.
Fünf Prinzipien für erfolgreiche Low-Code-Projekte
- Prozesse vor Software.
- Klein starten, groß denken.
- IT als Partner, nicht Gatekeeper.
- Visualisierung schafft Verständnis.
- Messen statt glauben.
Checkliste – in fünf Minuten prüfen
| Kriterium | Frage | Bewertung |
|---|---|---|
| Prozess dokumentiert? | Liegt eine aktuelle Ablaufbeschreibung vor? | ✅ / ❌ |
| Datenquelle eindeutig? | Ist die zentrale Datenbasis definiert? | ✅ / ❌ |
| Verantwortlicher benannt? | Ist klar, wer den Prozess steuert? | ✅ / ❌ |
| Risiken bewertet? | Sind Abhängigkeiten bekannt und berücksichtigt? | ✅ / ❌ |
| Kennzahlen definiert? | Gibt es messbare Ziele (Zeit, Kosten, Fehlerquote)? | ✅ / ❌ |
Go, wenn vier von fünf Punkten erfüllt sind und die Datenquelle eindeutig ist.
Pause, wenn der Prozess nicht dokumentiert oder kein Verantwortlicher benannt ist.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Start
Prozess sichtbar machen:
Visualisieren Sie Ihre Abläufe in einem Workshop – das schafft Klarheit.
Pilot auswählen:
Starten Sie mit einem klar umrissenen Bereich, z. B. Freigaben oder Angebote.
Kennzahlen festlegen:
Definieren Sie Zeit-, Kosten- und Qualitätsziele.
Plattform auswählen:
Offene Schnittstellen, im eigenen Rechenzentrum oder in einer Private-Cloud-Umgebung, ohne Herstellerbindung.
Ergebnisse prüfen:
Nach sechs Wochen messen, bewerten, ausweiten.
Low-Code ist kein Allheilmittel, sondern ein Werkzeug für Klarheit, Tempo und Eigenständigkeit. Es wirkt dort, wo Prozesse sauber beschrieben und Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sind.
Wer strukturiert startet, kann in sechs Wochen messbare Ergebnisse erzielen – ohne Risiko, ohne Schatten-IT, ohne IT-Überforderung.
Ergebnisgarantie:
Wenn Low-Code nicht passt, sagen wir es – mit Begründung und konkreter Alternative.